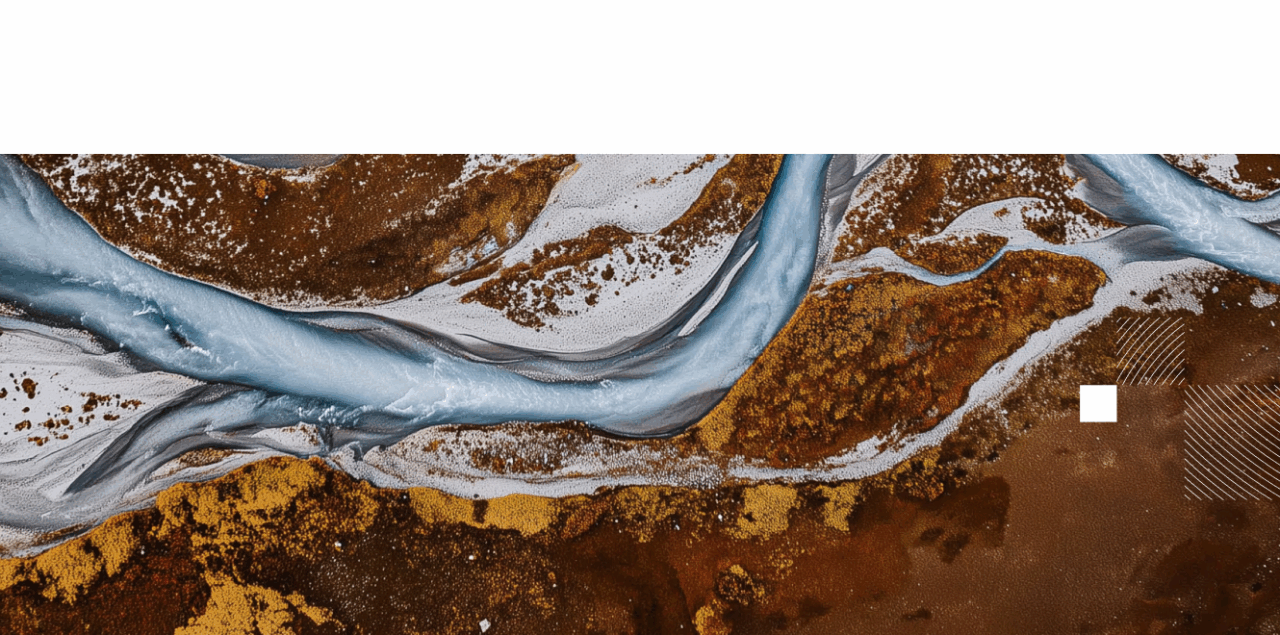
Die Industrialisierung der Data Science
Was früher kreative Pionierarbeit war, ist heute Ingenieursdisziplin. Data Science entwickelt sich zur produktiven Infrastruktur der KI – mit klaren Rollen, Prozessen und Qualitätsmaßstäben. Wie sich Unternehmen in dieser neuen Realität behaupten.
Eine Disziplin wird erwachsen
Wenn Daten vor zehn Jahren „das neue Gold“ waren, dann war Data Science das Werkzeug, mit dem man danach schürfte. Unternehmen suchten Generalist:innen mit einem seltenen Mix aus Statistikkenntnis, Programmiererfahrung, Cloud-Affinität und Businessverständnis. Diese Data Scientists agierten als Pioniere: Sie extrahierten Daten aus abgeschotteten Silos, entwickelten erste Vorhersagemodelle und beeindruckten mit vielversprechenden Prototypen – oft allein, noch öfter improvisiert.
In dieser Frühphase war Data Science vor allem Entdeckung – geprägt von Experimentierfreude, Open-Source-Enthusiasmus und akademischer Nähe. Viele dieser Projekte waren Proof-of-Concepts, oft ohne klares Zielbild für Betrieb und Skalierung. Unternehmen suchten in ihren Daten nach Mustern, aber selten nach strukturellen Fähigkeiten. Das Ergebnis war eine Vielzahl lokaler Erfolge mit Jupyter Notebooks, die den Sprung in die operativen Unternehmensprozesse nicht immer geschafft haben.
Heute hat sich dieses Bild komplett gewandelt. Der Markt erwartet nicht mehr kreative Einzelideen, sondern belastbare, reproduzierbare und skalierbare Ergebnisse. Data Science hat den Charakter einer Ingenieursdisziplin angenommen – mit definierten Standards, Toolchains und Qualitätsmaßstäben. Heute investieren auch Mittelständler in Data Platforms, MLOps und Governance-Strukturen, um aus der Versuchsanordnung eine produktive Infrastruktur zu machen.
Wenn KI kein Projekt mehr ist – sondern ein Produkt
Die meisten Unternehmen haben inzwischen gelernt: Ein gutes Modell im Jupyter-Notebook bedeutet noch lange keinen gut funktionierenden KI-Service. Zu oft scheiterten vielversprechende Use Cases an mangelnder Skalierbarkeit, fehlendem Monitoring oder unklarer Ownership. Laut einer Studie von IDC schaffen es rund 88 Prozent aller KI-Initiativen nie bis in den produktiven Einsatz – viele davon landen anschließend in der Entwicklungshölle, wo Prototypen endlos weiterentwickelt, aber nie produktiv genutzt werden.
Was sich verändert hat, ist der Maßstab. Ein KI-Modell muss heute wie jede andere digitale Komponente dauerhaft betrieben, aktualisiert und überwacht werden können. Das bringt neue Anforderungen mit sich – an Stabilität, Integrationstiefe, Sicherheit und Governance. Damit wird die Data Science von der Entdeckungsreise zur kritischen Infrastrukturarbeit.
Über die Hälfte der Unternehmen setzen inzwischen auf MLOps-Praktiken. Besonders in der Logistikbranche zeigen sich die Effekte dieser Professionalisierung deutlich: Gemeinsam mit einem globalen Logistikunternehmen hat Comma Soft eine (von der WirtschaftsWoche ausgezeichnete) Machine-Learning-Plattform entwickelt, die datengetriebene Entscheidungen entlang der gesamten Logistikkette ermöglicht – von der Routenoptimierung bis zur Prozessautomatisierung. Die Plattform ist Cloud-unabhängig, unterstützt sowohl On-Premises- als auch Multi-Cloud-Szenarien und integriert sich nahtlos in bestehende Systeme.
Damit hat sich die Data-Science-Praxis von einem laborhaften Versuchsfeld zu einer operativen Produktionsumgebung entwickelt. Die entscheidende Frage lautet heute nicht mehr, ob ein Modell funktioniert – sondern wie stabil es im Alltag läuft und wer dafür verantwortlich ist. Unternehmen, die diese Fragen beantworten können, haben den Übergang zur produktiven Phase geschafft.
Neue Rollen, neue Zuständigkeiten, neue Teams
Die technologische Reifung hat auch Auswirkungen auf Teamstrukturen. Wo früher ein einzelner Data Scientist die komplette Pipeline von Datenzugang bis Modellreporting verantwortete, ist heute Arbeitsteilung gefragt. Data Science ist zur Mannschaftsdisziplin geworden.
Der Data Scientist von gestern ist heute ein Team.
Laut einer Bitkom-Erhebung sehen 44 % der Unternehmen veränderte Rollen- und Aufgabenprofile im Kontext von KI. Ganz neu sind diese Funktionen nicht – sie gewinnen nur an Klarheit und Gewicht. Was früher oft implizit Teil der Data-Science-Rolle war, wird heute in spezialisierte Verantwortlichkeiten überführt. Damit geht auch ein Bedeutungsgewinn für ML und Data Engineers einher. Ein Trend, der sich auch international zeigt: Internationale Analysen von der OECD zeigen, dass Rollen wie ML- und Data Engineer deutlich stärker im Kommen sind als klassische Data-Scientist-Profile. Data Engineers bilden heute das Fundament jeder Datenstrategie. Sie sorgen für belastbare Pipelines, Datenqualität und Zugänglichkeit. ML Engineers übernehmen die Automatisierung, das Deployment und die Observability von Modellen. Prompt Engineers und LLM Engineers agieren an der Schnittstelle zwischen Mensch und Modell – sie gestalten die Interaktion mit Large Language Models und übersetzen Geschäftslogik in steuerbare Prompts. Und AI Product Owner halten alles zusammen: Sie denken in Produkten statt Projekten, bewerten Nutzen, Risiken und Verantwortlichkeiten und übersetzen regulatorische Leitplanken in konkrete Roadmaps.
Unternehmen gestalten ihre zentralen Data-Science-Einheiten mehr und mehr hin zu cross-funktionalen „AI Squads“, in denen Data Scientists, Engineers und Product Owner gemeinsam Produkte entwickeln. Damit wiederholt sich ein Muster, das die Softwareentwicklung schon vor 15 Jahren durchlaufen hat. Auch dort wandelte sich die Rolle des „Fullstack-Entwicklers“ hin zu spezialisierten, eng verzahnten Teams – von DevOps bis Qualitätssicherung. Continuous Integration, Delivery Pipelines und automatisierte Tests sind heute selbstverständlich. Genau dieselbe Industrialisierung prägt nun Data Science: weg vom Notebook in Handarbeit, hin zur professionellen Produktionskette.
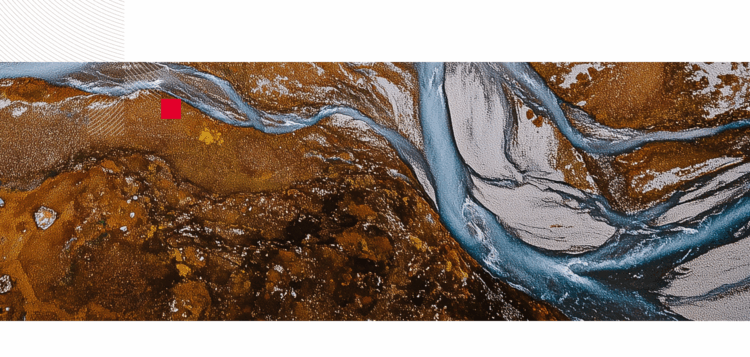
Verantwortung als Reifegradmerkmal
Mit der Operationalisierung wächst die Verantwortung. Sobald KI produktiv genutzt wird, steht sie unter doppeltem Druck: Sie muss funktionieren – und sie muss überprüfbar bleiben. In der Experimentierphase reicht es, wenn ein Modell gute Ergebnisse liefert. In der produktiven Phase zählt, ob diese Ergebnisse erklärbar, gerecht und kontrollierbar sind.
Das betrifft längst nicht mehr nur regulierte Branchen. Auch Investoren, Kunden und Mitarbeitende erwarten, dass Unternehmen mit ihren Daten und Algorithmen verantwortungsvoll umgehen. Reife Organisationen erkennen Governance nicht als Hürde, sondern als Bestandteil von Produktqualität.
Ein prominentes Beispiel liefert Mastercard. Das Unternehmen hat früh verstanden, dass Vertrauen kein Nebenprodukt ist, sondern das Betriebssystem einer skalierbaren KI-Organisation. Unter Leitung von John Hearty entstand dort eine zentrale AI-Governance-Unit, die alle produktiven Modelle auf Risiko, Transparenz und Fairness prüft. Dazu gehören verbindliche Model Cards (strukturierte Dokumentationen jedes Modells), standardisierte Bias-Tests, zentrale Audit-Trails und regelmäßige Model Reviews. Die Governance-Einheit arbeitet dabei nicht gegen, sondern mit den Data-Science-Teams – sie definiert Freigabeprozesse, die sicherstellen, dass KI-Anwendungen skaliert werden können, ohne Kontrollverlust zu riskieren.
Auch regulatorisch hat sich die Perspektive verschoben. Der EU AI Act, der im August 2024 in Kraft trat, macht Governance europaweit verbindlich. Hochrisiko-KI-Systeme – etwa in Finanzdienstleistung, Gesundheit oder Personalmanagement – müssen prüfbare Transparenz- und Sicherheitsstandards erfüllen: dokumentierte Trainingsdaten, Auditierbarkeit, menschliche Kontrollinstanzen und ein durchgängiges Risikomanagement über den Lebenszyklus. Dahinter steckt mehr als Compliance, denn die Vorgaben markieren den Übergang von freiwilliger Ethik zu verpflichtender Verantwortung. Laut Bitkom-Vorständin Susanne Dehmel bietet der AI Act die Chance, eine weltweite Führungsrolle bei vertrauenswürdiger KI einzunehmen – warnt aber vor „unnötigen bürokratischen Hürden“ und fordert eine hohe „Konsistenz mit der existierenden Gesetzgebung“. Auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft begrüßt den Ordnungsrahmen grundsätzlich, weist jedoch angesichts personeller und struktureller Gegebenheiten auf Umsetzungsprobleme hin.
Trotz dieser Kritikpunkte sehen viele Fachleute den EU AI Act als notwendigen Schritt zu einem europäischen Qualitätsversprechen: „Trustworthy AI“ als Standortvorteil. Governance wird damit zur messbaren Dimension von Reife – ähnlich wie Sicherheit oder Performance.
Die Reife einer Organisation zeigt sich daran, wie gut ihre KI-Rollen zusammenspielen.
Von Einzelmodellen zur lernenden Infrastruktur
Der eigentliche Paradigmenwechsel liegt tiefer, als viele denken. Reife Data-Science-Organisationen denken nicht mehr in einzelnen Modellen, sondern in lernenden Systemen. Früher wurde Erfolg an der Güte einer Vorhersage gemessen – heute an der Fähigkeit, diese Vorhersagen dauerhaft zu integrieren, zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern.
Dieser Wandel ist sowohl technisch als auch organisatorisch. Auf technischer Ebene geht es um modulare Architekturen, standardisierte Schnittstellen und wiederverwendbare Komponenten. Auf organisatorischer Ebene um Ownership, Feedback-Loops und die Bereitschaft, Modelle als lebendige Produkte zu begreifen. Ein Modell ist nicht mehr das Ziel, sondern ein Knoten in einem größeren, lernenden Netzwerk.
Ein anschauliches Beispiel liefert Cemex. Der Baustoffkonzern hat in den vergangenen Jahren eine Plattform aufgebaut, auf der Dutzende KI-Modelle nahtlos zusammenarbeiten – von Nachfrageprognosen über Lieferplanung bis hin zu Qualitätsanalyse und Energieoptimierung. Diese Modelle laufen nicht isoliert, sondern sind orchestriert, teilen Datenströme, überwachen sich gegenseitig und werden in kurzen Zyklen neu trainiert. Das Ergebnis: eine resilientere, schnellere Supply Chain, die in Echtzeit auf Marktveränderungen reagiert. Der entscheidende Punkt ist weniger technischer Natur als kulturell: Cemex behandelt KI als Produktionsressource – nicht als Forschungsprojekt. Eine Perspektive, die hoffentlich Schule macht.
Unterdessen zeigt UPS, wie sich datengetriebene Optimierung in industriellem Maßstab operationalisieren lässt. Das System ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation) nutzt schon seit 2016 Big-Data-Analytik und algorithmische Entscheidungsmodelle – Prinzipien, die später in MLOps-Ansätzen der KI wiederkehren. ORION errechnet täglich Millionen Liefersequenzen auf Basis aktueller Telematikdaten. Es lernt aus jeder Tour, passt Routen laufend an und reduziert dadurch nicht nur Kosten, sondern auch Emissionen – jährlich rund 40 Millionen Liter Treibstoff und 100.000 Tonnen CO₂. Das macht ORION zum Paradebeispiel für operative Integration im industriellen Maßstab – stabil, nachvollziehbar und mit klarem Business Impact.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das globale Logistikunternehmen mit der gemeinsam mit Comma Soft entwickelten ML-Plattform (mehr dazu auch in unserem Reisebericht #01). Ziel war dort weniger der einzelne Use Case als die Infrastruktur dahinter: ein standardisiertes Toolset, mit dem sich viele Modelle schnell, konsistent und wartungsarm entwickeln, integrieren und betreiben lassen. Am Ende stand damit eine Umgebung, in der Ideen zügig zu produktiven, skalierbaren Anwendungen werden – von Lieferkettenoptimierung über Bedarfsprognosen bis zur Klassifikation von Zollcodes. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist das begleitende Enablement: Mitarbeitende wurden gezielt geschult, um die Plattform effizient zu nutzen und neue ML-Use-Cases eigenständig voranzutreiben. So wirken technische Standardisierung, MLOps-Prinzipien und Organisationsentwicklung zusammen, um Data Science nachhaltig produktiv zu machen.
Diese Beispiele illustrieren, dass der Reifegrad von Data-Science-Projekten sich nicht zuletzt an der Integrationsfähigkeit messen lassen muss: Ist KI fester Teil des Systems oder nur ein Add-on?
Für viele europäische Unternehmen markiert genau das den nächsten Entwicklungsschritt. Nach Jahren der Experimentierphase geht es nun darum, lernende Systeme zu schaffen, die sich in Wertschöpfungsketten einfügen, statt neben ihnen zu stehen. Das erfordert neue Kompetenzen, aber auch Mut zur Standardisierung. Nur wer KI als Infrastruktur begreift, kann nachhaltig skalieren.
Vorsprung durch Vertrauen?
Kaum ein Thema spiegelt die kulturellen Unterschiede in der globalen KI-Strategie so deutlich wider wie der Umgang mit Verantwortung. Während die USA auf Geschwindigkeit, Marktdynamik und Selbstregulierung setzen und China eine zentral gesteuerte Entwicklung verfolgt, entsteht in Europa ein dritter Weg – der der verantwortungsbewussten Skalierung. Dieser Ansatz ist weder technikfeindlich noch bürokratisch, wie oft behauptet wird, sondern folgt einer ökonomischen Logik: Vertrauen ist ein Produktionsfaktor. Wer nachweisen kann, dass seine KI nachvollziehbar, fair und sicher arbeitet, verschafft sich Zugang zu Märkten, Kunden und Partnern, die genau das erwarten – in der Finanzwirtschaft ebenso wie in Industrie, Healthcare oder Verwaltung. Der EU AI Act ist die politische Manifestation dieser Haltung. Er schreibt keine Technologie vor, sondern legt verbindliche Rahmenbedingungen fest: Fairness, Nachvollziehbarkeit, Sicherheit. Damit wird Europa zum ersten Wirtschaftsraum, der „Trust by Design“ als Innovationsstrategie verankert.
Die Zukunft der Data Science ist das Bauen von Brücken zwischen Mensch, Maschine und Bedeutung.
Natürlich birgt Regulierung immer das Risiko, Innovationsgeschwindigkeit zu bremsen. Doch genau hier liegt der eigentliche Imperativ für Europa: aus Regulierung einen Standortvorteil zu machen. Wer Governance nicht als Hürde, sondern als strategisches Gestaltungsfeld versteht, sichert nicht nur Compliance, sondern Wettbewerbsfähigkeit.
Für europäische Unternehmen bedeutet das: Jetzt ist der Moment, eigene Governance-Kompetenz aktiv auszubauen. Wer heute transparent, erklärbar und auditierbar arbeitet, schafft die Basis, auf der sich KI verantwortungsvoll skalieren lässt. „KI made in Europe“ steht dann nicht für technologische Vorsicht, sondern für nachhaltige Innovationskraft. So zeigt etwa Bosch, wie sich Vertrauen operationalisieren lässt – mit einem Set ethischer Richtlinien, anhand derer sich jede KI-Anwendung prüfen lässt (Fairness, Transparenz, Erklärbarkeit).
Auch wir bei Comma Soft verfolgen diesen Ansatz sowohl in unseren Beratungsprojekten zu Data und AI als auch mit der sicheren und souveränen KI-Plattform Alan: Sie vereint technische Skalierbarkeit mit eingebauter Governance – von nachvollziehbarer Datenherkunft bis hin zu kontrollierbaren Modellentscheidungen. Globale KI-Systeme werden zunehmend zu Black Boxes. Das macht Transparenz zu Europas härtester Währung – und vielleicht der einzigen, die langfristig Vertrauen in Technologie sichern kann.
Von der Entdeckerphase zur Verantwortungskultur
Data Science steht am Übergang zur nächsten Stufe. Die Pionierzeit war geprägt von Neugier, Improvisation und Mut zum Experiment. Jetzt zählt Gestaltungsfähigkeit. Um Erkenntnisse auch in belastbare Infrastrukturen zu gießen – und aus ergebnisoffenen Experimenten verantwortungsvolle, skalierbare Lösungen zu machen.
Die Zeiten des Einzelkämpfers und des experimentellen Bastelns sind vorbei. Die nächste Generation der Data-Science-Organisationen denkt in Ökosystemen: Sie vernetzt Menschen, Maschinen und Modelle so, dass aus Daten echte Entscheidungen werden können. Skalierung, Transparenz und Governance sind dabei zentrale Voraussetzungen für Wertschöpfung in dem neuen Zeitalter.
Was bleibt, ist der Kern der Disziplin: der Wille, Wissen aus Daten zu gewinnen. Was neu hinzukommt, ist das Bewusstsein, dass dieser Prozess nie neutral ist. Jede Modellentscheidung ist auch eine Organisationsentscheidung über Verantwortung und Vertrauen.
Damit verschiebt sich der Fokus. Weg vom Modell, hin zum System. Weg vom Code, hin zur Architektur. Weg vom reinen Technologie-Fokus, hin zu einer gestaltenden Organisation, die Verantwortung nicht als Pflicht, sondern als Kompetenz versteht.
Wir machen aus einer Idee echte Infrastruktur
Wie reif ist Ihre Data Science? Lassen Sie uns darüber sprechen, wie sich Stabilität und Vertrauen verbinden lassen.